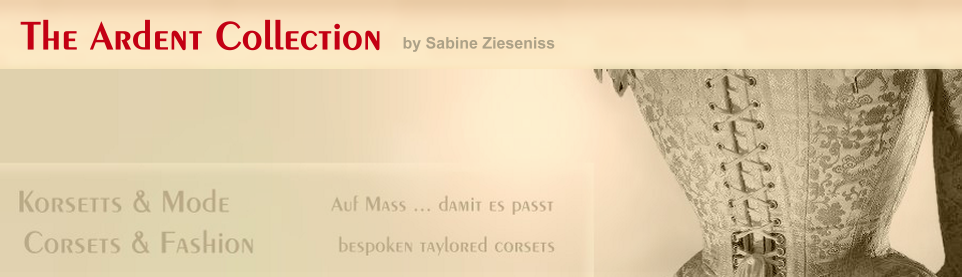Material
Kennzeichnung der Textilien
Textilkennzeichnungsgesetz
Definition
Das deutsche Textilkennzeichnungsgesetz (TKG) ist den Textilkennzeichnungs- richtlinien der Europäischen Gemeinschaft angepasst. Es ist für Industrie, Handel und Verbraucher verbindlich und regelt in Bestimmungen die Rohstoffgehaltsangabe fast aller dem Endverbraucher angebotenen Textilerzeugnisse (das sind zu mindestens 80% aus textilen Rohstoffen hergestellte Waren).
Ziel des Gesetzes ist es, den Verbraucher beim Kauf von Textilien darüber zu informieren, aus welchen textilen Rohstoffen ein Erzeugnis besteht. Es schreibt die Bezeichnung der verschiedenen Faserarten vor, gibt deren Gewichtsanteile an und verpflichtet zur Rohstoffgehaltsangabe in genau festgelegten Bezeichnungen. In Paragraph 8 des Gesetzes wird die Auszeichnung zusammengesetzter Erzeugnisse geregelt. (Neufassung des Textilkennzeichnungsgesetzes vom 14. August 1986 [BGBl. I, S. 1285]. Anm.
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, handelt es sich bei diesen Seiten nicht um einen Verkaufskatalog und die dargestellten Modelle sind nicht über den Internetdirektversand zu beziehen. Wie ebenfalls bereits dargestellt, dienen diese Seiten in erster Linie dem Zweck, die designerische Umsetzung neuer Modelle sowohl im Hinblick auf Modellvariationen in unterschiedlichen Stilrichtungen, als auch deren Wirkung in unterschiedlichen Materialien zu veranschaulichen.
Insofern hat die Kennzeichnung der Materialien an dieser Stelle lediglich präventiven Character, da die Darstellung der Materialzusammensetzungen stets während der Beratungsgespräche erfolgt, bei denen der zu Beratende sich nicht nur von der quantitativen Zusammensetzung (Angaben des Vorlieferanten), sondern gleichfalls von der Ausführungsqualität (sehen, fühlen) überzeugen kann, aber auch seine eigenen Stoffe vorlegt.
Sofern in den Modellbeschreibungen auf den vorhergehenden Seiten nicht anders dargestellt, wurden hier ausschließlich Gewebe verwandt, deren Warenbezeichnung nachstehend aufgeführt ist. Die angegebenen Faser-/Garnmischungen in den Warenbezeichnungen beziehen sich hierbei auf das Gewebekollektiv, während die jeweiligen Faserreinheiten mit 100% anzusetzen sind.
Seide jacquardgemustert/Seide ungemustert:
100% Reine Seide (SE)
Satin:
60% Baumwolle (BW)
40% Viscose (VI)
Brokat:
Baumwollanteil 100% Baumwolle(BW)
Lurexanteil 100% Lurex ®
Anteil Baumwolle-/Lurex ® = Musterabhängig
Damast
100% Baumwolle (BW)
Drell
100% Baumwolle (BW)
Lack
50% Polyvenylchlorid (PVC)
45% Polyester (PES)
5% Elastan
Leder
100% Leder
Anm:
zitiert von:www.raumausstattung.de
Original-Quelle: Brebeck, Kommentar zum Textilkennzeichnungsgesetz, Deutscher Fachverlag GmbH Frankfurt/Main, 1987)
Kleiner Materialalmanach
Für ein Korsett sind naturgemäß Flachgewebe am geeignetsten, da sie sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung in der Regel keinen Verzug, bzw. kaum Dehnung aufweisen. Hier muß allerdings vorausgesetzt werden, daß bei den korsettrelevanten Geweben keine elastischen Garne/Fäden eingesetzt werden.
Unterscheidung nach Gewebebindung
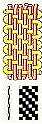
Für die im Korsettbereich eingesetzten Gewebebezeichnungen sind die Bindungsarten Köper- und die Atlasbindung überwiegend, wobei die Atlasbindung aufgrund der vielfältigen Musterungsmöglichkeiten im Oberstoff deutlich überwiegt, während die Gewebe mit Köperbindung in erster Linie im Korsettinnenleben anzutreffen sind (Drell, Drillich) und in der Regel ausser den Bindungsstrukturen keine Musterungen aufweisen.
Insofern soll an dieser Stelle auch nicht weiter erläutert werden, daß die Köperbindung mindestens dreibindig ist und sich hieraus eine mehr oder weniger stark erscheinende diagonale Streifenwirkung ergibt, die in verschiedenen Konstruktionen auftreten kann.
 Der Atlasbindung kommt für den Korsettbereich die größere Bedeutung zu, deshalb sollen in diesem Zusammenhang ein paar wenige zusätzliche Unterscheidungen, die im Fachjargon jedoch häufig anzutreffen sind, weitere Unterscheidungen verdeutlichen.
Der Atlasbindung kommt für den Korsettbereich die größere Bedeutung zu, deshalb sollen in diesem Zusammenhang ein paar wenige zusätzliche Unterscheidungen, die im Fachjargon jedoch häufig anzutreffen sind, weitere Unterscheidungen verdeutlichen.
Zu unterscheiden sind Kett- und Schussatlas, wobei das hochwertigere Material in der Regel in der Warenoberfläche flottiert. Beim Kettatlas bindet ein Kettfaden über vier und jeweils unter einem Schussfaden. Die Gewebeoberseite wird somit durch die Kette bestimmt. Umgekehrt bindet beim Schussatlas der Schussfaden über vier und unter einem Kettfaden, die Gewebeoberseite wird somit durch den Schussfaden bestimmt. Gemäß der verstreuten Bindungspunkte entsteht somit, je nach Art der verwendeten Faserstoffe und der Flottierung, eine mehr oder weniger glänzende, strukturlose und gleichmäßige oberfläche (Warenbezeichnungen: Duchesse, Liberty, Merveilleux, Soleil, Damassé, Crepê Satin).
Nach der Technologie unterscheidet man:
Schaftgewebe und Jacquardgewebe
Während bei den Schaftgeweben bei den Köper- und Atlasbindungen (Drell, Satin) eine Vielzahl von Kettfäden zusammengefasst und gemeinsam in Gruppen gehoben und gesenkt werden, ist bei den Jacquardgeweben die Anzahl der zu Gruppen zusammengefassten Kettfäden klein. Im Extremfall kann jeder Kettfaden einzeln gesteuert und entsprechend der Musterung gehoben oder gesenkt werden. Die Jacquardtechnik ermöglicht im Bereich der Flachgewebe die volle Ausschöpfung der durch die Technologie gegebenen Musterungsvielfalt, speziell großflächiger, ein- und mehrfarbiger Dessignierungen. Verwendete Musterbezeichnungen sind Brokat, Damast, Damassé, Gobelins, Matelassé, oder zahlreiche Einzelbezeichnungen, wie z.B. Jacquardbrokat, Jacquarddamast, Jacquardgobelin etc., die in der Wortzusammensetzung auf diese Webtechnik verweisen.
Insofern können wir jetzt nach Bindung und Webtechnologie unterscheiden:
Echter Damast (Bild)
Gekennzeichnet durch gruppenweise abgestufte Konturen, wobei die Muster durch den Wechsel von Kett- und Schussatlasbindung entstehen.
Unechter Damast oder Halbdamast (auch als Jacquarddamast bezeichnet)
Sie können sowohl nur in Kett- und Schussatlas als auch mit Köperbindung gewebt werden. Hierdurch erreicht man die besonders plastische Musterbildung mit glatten, abgerundeten Konturen.
Brokat-Damast
Hierbei handelt es sich um ein feinfädiges Gewebe in Jacquardmusterung mit einer Mindestfadendichte von 88 Fäden/cm².
Im klassischen Sinne war Damast ursprünglich ein unifarbenes, schweres Seidengewebe in Kett- und Schussatlasbindung in großflächiger Blumenmusterung, deren Konturen durch die Gruppenaushebung der Kettfäden hervortreten. Heute versteht man unter Damast allgemein alle vereinfachten, mittel- bis feinfädigen, atlasbindigen und großgemusterten jacquardgewebten Stoffe aus Baumwolle, Leinen, Halbleinen, Chemieseide, Seide und Wolle. Der Musterkontrast zwischen Fond- und Figurflächen wird durch den Wechsel zwischen Kett- und Schussatlas-Bindung bewirkt, wodurch je nach Lichteinfall die reversiblen Muster plastisch hervortreten.
Echte Damaste erkennt man an den gruppenweise abgestuften Konturen. Die Muster entstehen durch den Wechsel von Kett- und Schussatlasbindungen. Gewebt werden die echten Damaste auf Damast-Jacquardmaschinen, die zum Bilden der einfädigen Kett- und Schussatlasbindung besondere Vorrichtungen haben.
Unechte Damaste, die auch als Jacquarddamaste bezeichnet werden, zeigen bei einfädiger Abstufung eine glattkonturige Musterung. Sie können sowohl nur in Kett- und Schussatlas als auch mit schattierender Atlas- und/oder Köperbindung gewebt und mit Panama-, Rips- oder Leinwandbindung verziert werden. Hierdurch erreicht man die besonders plastische Musterbildung mit glatten, abgerundeten Konturen.
Jacquardgewebte Flachgewebe, die ihr besonderes Aussehen durch eingewebte Metallfäden (Lurex ®-Fäden) erhalten.
Brokatelle (Bild)
Jacquardgewebte Flachgewebe, die jedoch anstelle der beim Brokat üblichen Metall- oder Lurex ®-Fäden in Gold oder Silber eingefärbte Chemiefasern verwendet.
Satin (franz. satiné = seidig) (Bild)
Feinfädiges Gewebe in Atlasbindung mit einer mehr oder weniger glänzenden, glatten Oberfläche, das aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden kann, wobei die Bezeichnung Atlas für die robusteren Gewebekonstruktionen und Satin für die leichteren Stoffe verwendet wird. Zu unterscheiden sind Schuß- oder Kettatlas, wobei jeweils das hochwertigere Material auf der Warenoberfläche liegt. Die Materialzusammensetzung wird meist als Zusatzbezeichnung mit dem Begriff erwähnt (Baumwollatlas, Seidensatin).
Der Satin besticht durch seine fein anmutende und stark glänzende Oberfläche. Die Vorzüge des Satin liegen im ästhetischen Bereich und haben im wesentlichen dekorativen Charakter, ist also nur für leichte Beanspruchung und schonenden Gebrauch gedacht. Satin ist empfindlich gegen Wassertropfen. Satin wird vorwiegend unifarben, meist aus Viskose, Baumwolle und Seide oder auch aus Chemiefasern hergestellt. Aber im Gegensatz zum Seidenglanz der Seide ist der 'Satinglanz' offensichtlicher.
Duchesse
Feinfädiges, atlasbindiges Gewebe aus Natur- oder Chemieseide mit sehr hoher Kettdichte.
gebräuchliche Faserstoffe für Korsetts
Seide (Bild)
Neben dem edlen Glanz, der Geschmeidigkeit und Feinheit des Materials zeichnet sich Seide durch ein hohes Dehnungsvermögen und Festigkeit bei geringstem Materialgewicht aus. Sie ist knitterarm, hautsympathisch und besitzt eine gute Isolationsfähigkeit bei Wärme und Kälte.
Baumwolle
Feuchtigkeitsaufnahme bis zu 32% des Eigengewichts, ohne sich naß anzufühlen. Die Reissfestigkeit der Baumwolle kann ebenfalls als sehr gut bewertet werden, im feuchten Zustand sogar höher als im trockenen Zustand. Allerdings ist das Wärmerückhaltevermögen gering, da Wärme gut abgeleitet wird. Baumwolle hat von sich aus nur einen geringen Glanz, der jedoch durch Mercerisation erhöht werden kann.
Kunstfasern
Polyamid, Polyester, Acetat etc. sollten für den Korsettbereich eigentlich keine Bedeutung haben, wenngleich sich mit diesen Materialien durchaus Optiken erzielen lassen, die im Naturfaserbereich nur durch den teueren Rohstoff an sich, oder durch aufwendigere Ausrüstungsverfahren erzielen lassen.
Wie unterscheidet man am einfachsten Faserstoffe?
Die Brennprobe ist das schnellste und einfachste Verfahren, um in etwa die Rohstoffkategorie einordnen zu können. Hierzu nimmt man ein loses Garnende heraus und hält es vorsichtig über ein Feuerzeug (kein Streichholz, da ein brennendes Streichholz von vornherein nach verbrennender Cellulose riecht).
Durch den unterschiedlichen Geruch lassen sich Fasern auf Cellulosebasis (Baumwolle, Leinen, Viskose = Geruch: schmorendes Papier) von tierischen Fasern (Seide, Wolle = Horngeruch) unterscheiden. Synthetische Chemiefasern (PA, PES, Acetat) erkennt man am Zusammenschmelzen der Faserprobe. Fasermischungen lassen sich durch die Brennprobe nicht feststellen - zumindestens nicht in ihrer quantitativen Zusammensetzung.
Weitere gebräuchliche Korsettmaterialien
Leder
Leder ist ein besonderes Material. Es vermittelt Körperlichkeit, verleiht eine archaische Ausstrahlung und läßt in seiner Echtheit keine Zweifel zu. Leder erfordert in der Verarbeitung besondere Sorgfaltskriterien. Angewandt wird eine Verarbeitung, bei der besonders feine Leder zu hautengen Modellen mit Garantie auf Formbeständigkeit und Haltbarkeit verarbeitet werden.
Lack
Lack wirkt durch seine glatte Oberfläche und seinen Glanz "cool". Lack birgt Geheimnisse, ist spannungsvoll und energiegeladen. Die Lackoptik ist entweder durch den Einsatz von Lackleder möglich, bei dem die Lackschicht auf ein Leder laminiert ist, oder durch den Einsatz von Lackstoffen, bei dem die Lackschicht auf einen Stoff laminiert wurde.
Am Rande ...
Eine der am häufigsten auftretenden Fragen wird vor dem Hintergrund großer oder kleiner Oberweiten gestellt, die die Entscheidung für oder wider ein Korsett oftmals schwierig erscheinen lassen. Dieser Problematik können jedoch angepaßte integrierte Körbchen abhelfen, so daß dem eigentlichen Korsettwunsch kein Argument mehr entgegensteht.
 Verborgene Interessen - Crossdressing, TV und Transgender
Verborgene Interessen - Crossdressing, TV und Transgender
Auch Männer mögen das Gefühl des Umschlossen seins; mal mit, mal ohne Drang nach weiblicher Körperform.
Der Reiz dieser Thematik liegt in erster Linie darin, durch das Korsett der Umgebung ein verstärktes Selbstbewußtsein zu demonstrieren, gelegentlich aber auch dem maskulinen Körper gewisse feminine Attribute zu verleihen.
 Vollsteifes historisches Rokoko-Korsett oder Schnürleib (balleine)
Vollsteifes historisches Rokoko-Korsett oder Schnürleib (balleine)
Der Schnürleib, bzw. das Rokoko-Korsett ist in der Regel ein Halbbrust-Korsett und formt in erster Linie den Oberkörper und weniger die Taille. Er hat dementsprechend seine Auswirkung auf den weiblichen Brustbereich, indem hier das Dekoltee angehoben und flach gehalten wird.
 Viktorianisches Halbbrustkorsett 'Heather
Viktorianisches Halbbrustkorsett 'Heather
Original um 1890
Auch bei diesem Halbrustkorsett handelt es sich um ein Replikat einer Originalvorlage, die auch in etwa auf den Zeitraum um 1890 zu datieren ist. Die Stangentunnel sind rechts und links mit braunen Paspeln abgesetzt und entsprechen in der Stangenführung dem Original.
 Viktorianisches Korsett 'Crystal'
Viktorianisches Korsett 'Crystal'
Die Darstellung zeigt das Halbbrust-Korsett 'Crystal' im Viktorianischen Stil, welches im Schnitt und der Stangenführung einer Originalvorlage nachempfunden wurde.
Abweichend vom Original ist in dem dargestellten Korsett zur Ehöhung des Tragekomforts eine Unterplanchette eingearbeitet.
 Viktorianisches Korsett um 1890 'Jasmin' (Korsett-Replikat)
Viktorianisches Korsett um 1890 'Jasmin' (Korsett-Replikat)
Bei dem zugrunde liegenden Original handelt es sich um ein Korsett, dessen Ursprung in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zu suchen ist. Das Original-Korsett besteht im Oberstoff aus einem schwarzen Seidensatin und im darunter liegenden Futter aus einem leichten Baumwoll-Gabardine.
Die Stangen des Originals bestehen, wie zur damaligen Zeit üblich, aus Fischbein (hier: 40 Stäbe) von 1 mm Dicke und 2,5 mm Breite.
Stoffauswahl
Seide, Brokat, Satin und Leder
Alle auf diesen Seiten gezeigten Korsetts sind in den Obermaterialien Seide, Brokat, Satin, oder als Lederkorsett, bzw. Lack-Korsett erhältlich.
Die Materialien haben in erster Linie dekorativen Character. Das Innenleben des Korsetts besteht immer aus festem Drell und falls gewünscht, aus einem zusätzlichen Seidenfutter.
Meist gelesen
- Startseite
- Masskorsett
- Newsletter Nutzungsbedingungen
- Verborgene Interessen - Crossdressing, TV und Transgender
- Moderne Linienführungen - tragbar und gesellschaftsfähig -
- Korsettstil S-Line
- Korsetts und Mode
- Männerkorsett "Amadeo" (Westenkorsett) stark tailliert
- Haltungskorsett für Männer (Trainigskorsett)
- Haftungsausschluss (Disclaimer)
- Impressum
- Historie des Korsetts (19.Jhd. - 21.Jhd.)
- Korsett mit Körbchen (Cups)
- Zeitgemäße Adaption historischer Korsett-Stilelemente
- Vollsteifes historisches Rokoko-Korsett oder Schnürleib (balleine)